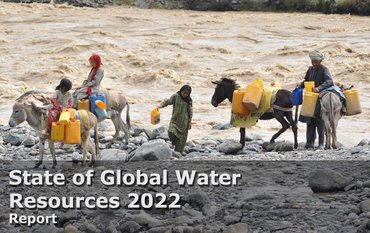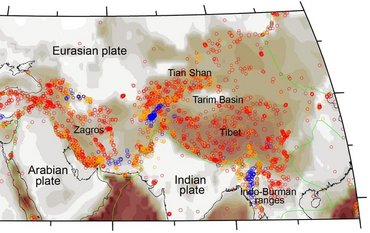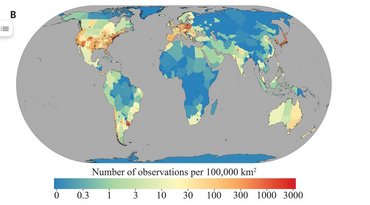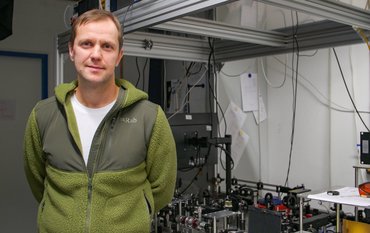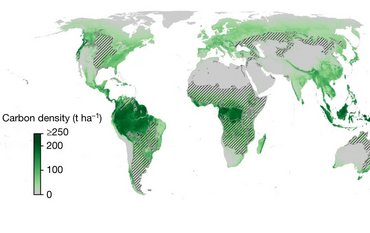Im Sommer 2022 hat die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina einen Zukunftsreport Wissenschaft „Erdsystemwissenschaft – Forschung für eine Erde im Wandel“ herausgegeben. Zusammenfassend schreibt sie:
„Um die Erde als Ganzes zu begreifen und effektiv zur Lösung der globalen Herausforderungen beizutragen, sollten die Geowissenschaften in Deutschland modernisiert werden und künftig von der Leitidee der Erdsystemwissenschaft geprägt sein. Das empfiehlt die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Zukunftsreport Wissenschaft „Erdsystemwissenschaft – Forschung für eine Erde im Wandel“. Der Report gewährt einen Überblick über das Forschungsfeld und schlägt Maßnahmen zur Etablierung des Konzepts vor.“
Anlässlich des heutigen Symposiums der Leopoldina „Erdsystemwissenschaft: Eine neue Leitidee für die Geowissenschaften“ schlägt das GFZ in einem Positionspapier vor, insbesondere Nachwuchsforschende stärker in die Diskussion um die Zukunft der Geowissenschaften einzubeziehen.
Das vollständige GFZ-Positionspapier:
Als Deutsches GeoForschungsZentrum haben wir den Blick auf die Erde als System und damit die Geoforschung als „Erdsystemwissenschaft“ seit vielen Jahren in unserer Vision verankert: „Die Zukunft kann nur sichern, wer das System Erde und die Wechselwirkung mit dem Menschen versteht: Wir entwickeln ein fundiertes System- und Prozessverständnis der festen Erde sowie Strategien und Handlungsoptionen, um dem globalen Wandel und seinen regionalen Auswirkungen zu begegnen, Naturgefahren zu verstehen und damit verbundene Risiken zu mindern sowie den Einfluss der Menschen auf das System Erde zu bewerten.“
Der jüngst erschienene Zukunftsreport Wissenschaft der Leopoldina „Erdsystemwissenschaft“ ist ein wichtiger Impuls, der aktueller denn je ist. Die Themen Klima- und Biodiversitätskrise, Energieversorgung, Extremereignisse, Rohstoffsicherheit und Nachhaltigkeit haben eine außerordentlich hohe gesellschaftliche Relevanz und in den Jahren seit 2018 – dem Beginn der Befassung der Leopoldina – nochmals an Bedeutung gewonnen. Wir sehen den Zukunftsreport als eine Diskussionsgrundlage für die Geowissenschaften im Allgemeinen und auch für die Diskussion in unserem Zentrum.
Als besonders wichtig erachten wir den integrativen Ansatz des Zukunftsreports für alle Teilbereiche der Geowissenschaften und den selbstkritischen Blick auf die immer noch bestehende Fragmentierung der Geowissenschaften. Es wird eine Aufgabe für die nächsten Jahre sein, zu einem Schulterschluss der Fachgesellschaften, der außeruniversitären Forschungseinrichtungen und der Hochschulen zu kommen. Nicht vergessen werden dürfen dabei auch die Fachhochschulen, die einen wichtigen Teil der Ausbildung für angewandte Geowissenschaften leisten.
Zu Recht heben die Hauptautoren des Zukunftsreports Veränderungsbedarfe an vielen Stellen hervor, zum Beispiel, was die systemische Sichtweise der Geowissenschaften, Big Data und Studieninhalte bzw. die universitäre Lehre betrifft. Aus unserer Sicht gibt es vielerorts bereits Initiativen und Projekte, die diese Themen adressieren. Das gilt sowohl für die programmorientierte Förderung der Helmholtz-Gemeinschaft mit dem großen Forschungsprogramm „Changing Earth – Sustaining our Future“ als auch für eine ganze Reihe von Universitäten und Fachhochschulen. So haben sich zahlreiche durch die DFG geförderte Verbundprojekte mit Beteilung vieler deutscher Universitäten ganzheitlich und systemisch diesen Themen zugewandt, darunter Sonderforschungsbereiche, Exzellenzcluster und Schwerpunktprogramme. Auch das BMBF und das BMWK fördern mit ganzheitlicher Verbundforschung Programme, die zur Energiewende beitragen, z.B. das Fachprogramm „Geoforschung für Nachhaltigkeit (GEO:N)“. Wir sehen hier jedoch den Bedarf, die Initiativen innerhalb der breiten geowissenschaftlichen Gemeinschaft systematisch zu erfassen und Koordinator:innen dieser Initiativen zur Diskussion einzuladen, um eine Verbindung zu schaffen.
Wichtig erscheint uns, dass die junge Generation von Forschenden – angefangen von Studierenden über Doktorand:innen bis hin zu PostDocs – stärker als bisher in die Debatten um die Zukunft ihres Fachs bzw. ihrer Disziplinen einbezogen werden. Auch Diversität in der Forschung ist ein Thema, das gerade bei den Geowissenschaften, die international und in vielen Kulturkreisen tätig sind, noch mehr in den Blick rücken sollte.
Der Zukunftsreport geht auch auf geowissenschaftliche Studiengänge und -abschlüsse ein, für die er einen unklaren Fokus attestiert. Als Lehrende und Forschende haben wir täglich mit Studierenden zu tun und teilen den Ansatz des Reports, die Erde als System zu begreifen. Zugleich ist es uns wichtig, dass Studierende, die für weiterqualifizierende Arbeiten zu uns kommen, ein tiefes Verständnis ihrer jeweiligen Teildisziplinen haben. Wie dieser Ambivalenz von Disziplinen-übergreifendem Fokus auf Erdsystemwissenschaften und fachlicher Tiefe in Teildisziplinen begegnet werden kann, muss sowohl mit den Hochschulen als auch mit den Studierenden diskutiert werden.
Ähnliches gilt für die geforderten Lehrinhalte zur Professionalisierung der Kommunikation mit der Gesellschaft und mit anderen Forschungsdisziplinen. Die eingangs erwähnten Krisen und Problemfelder hängen vielfach miteinander zusammen und erfordern einen multi- und transdisziplinären Ansatz zur Lösung. Dazu gehört auch das Leitmotiv, die Erde und die Menschen als System zu begreifen. Gerade die Geowissenschaften haben hier die Chance, ihre Stärken auszuspielen. Dies kann jedoch nur gemeinsam mit den jungen Forschenden, die es betrifft, diskutiert werden. Der Zukunftsreport Wissenschaft der Leopoldina „Erdsystemwissenschaft“ ist ein Startpunkt für diese wichtige Zukunftsdiskussion. Gemeinsam bilden wir die geowissenschaftliche Gemeinschaft und gemeinsam sind wir für die Gestaltung ihrer Zukunft verantwortlich.
16. Dezember 2022
Prof. Dr. Susanne Buiter – als Wissenschaftliche Vorständin
Prof. Dr. Charlotte Krawczyk – als GFZ-Programmdirektorin unseres
Forschungsprogramms „Changing Earth – Sustaining our Future“