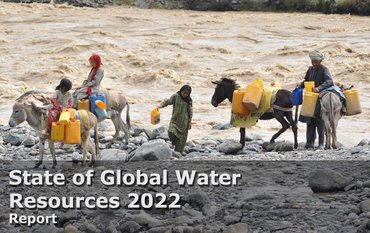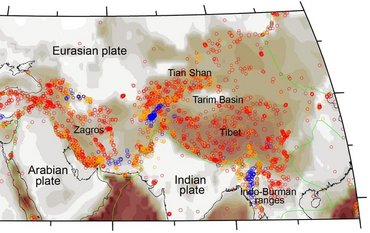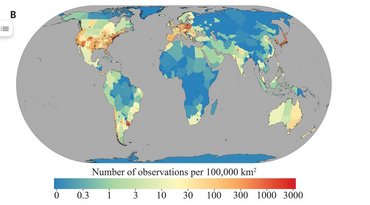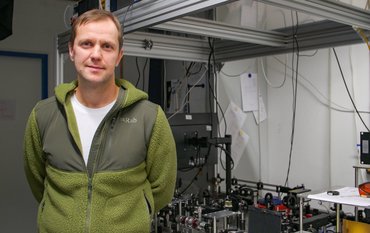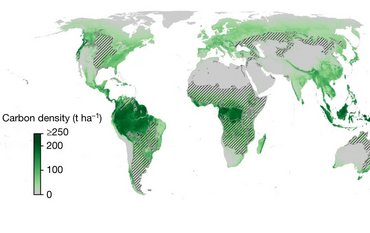Die ältesten Tiere tauchen in Fossilien vor etwa 570-550 Millionen Jahren in den Ediacara Biota Gemeinschaften auf. Diese Organismen können uns helfen zu verstehen, wie die heutigen Tiere und letztendlich Menschen entstanden sind.
Die meisten Ediacara-Lebewesen waren groß, teils sogar sehr groß, bis zu 1,5 Meter lang. Sie hatten einen komplexen Aufbau und sahen völlig fremdartig aus. Wissenschaftler:innen sind sich zwar ziemlich sicher, dass die meisten von ihnen tierartig waren, aber sie wissen nicht genau, zu welcher Art von Tieren sie gehörten. Vom Aussehen her können Wissenschaftler:innen sie nicht als direkte Vorfahren der heutigen Lebewesen identifizieren. Unter diesen seltsamen Riesen finden sich manchmal Tiere, die einem bekannt vorkommen können. Kimberella, zum Beispiel, ähnelt stark einer Meeresschnecke, wenn auch einer, die aus irgendeinem Grund rückwärts krabbelt. Es gibt auch Überreste von Röhrenwürmern wie Sabellidites und Calyptrina, die aussehen, als hätten sich einige Röhrenwürmer in den 550 Millionen Jahren der Evolution nie verändert. Wie haben sich solche Tiere entwickelt, und wie ähnlich waren sie den heute lebenden Tieren? Wie verhielten sie sich, wie und von was haben sie sich ernährt? Die letzte diese eben genannten Fragen könnte sich besonders als besonders wichtig erweisen, da die Ernährung möglicherweise den wichtigsten limitierenden Faktor in der frühen Evolution der Tiere darstellt. Klar ist: Bakterien können als Nahrungsgrundlage einen Tierorganismus nicht unterhalten. Dieser benötigt Algen oder andere komplexe Organismen in seiner Nahrung.
Die Wissenschaftler:innen verwenden in ihrer Studie eine unkonventionelle Methode, um die Überreste dieser ältesten bekannten Tiere zu untersuchen: Anstatt zu erforschen, wie sie aussehen, haben sie einen Weg gefunden, die Überreste der Moleküle zu analysieren, aus denen ihre Körper aufgebaut waren, mithilfe sogenannter Biomarker. Der Fokus liegt dabei vor allem auf versteinertem Fett, auf den Resten von Cholesterin und ähnlichen Molekülen. Mit dieser Technik konnten sie bereits bestätigen, dass die fremdartig aussehende Ediacara-Kreatur namens Dickinsonia tatsächlich zu unseren tierischen Vorfahren gehörte.
In dieser neuen Studie konnten sie die molekulare Signatur der letzten Mahlzeit in den Eingeweiden der schneckenartigen Kimberella und des Röhrenwurms Calyptrina voneinander abgrenzen. Während der schneckenartige Kimberella die mikrobiellen Matten, die den urzeitlichen Meeresboden bedeckten, abkratzte, fing Calyptrina das, was im Meerwasser schwamm, beiden Tieren gemein war eine Mischnahrung aus Grünalgen und Bakterien. Trotz ihres Vorkommens vor so langer Zeit waren ihr Sterin-Stoffwechsel und die Art der Nahrungsverdauung bereits mit denen heutiger Meerestiere vergleichbar. Dickinsonia hingegen besaß laut ihren Erkenntnissen überhaupt keinen Darm und nutzte einen anderen Ernährungsmechanismus, möglicherweise eine externe Verdauung, analog zu den heutigen Placozoa oder Seesternen.
Insgesamt zeigen die Lipid-Biomarker eine Reihe von Ernährungsstrategien in Ediacara-Gemeinschaften auf, was verdeutlicht, dass einige Ediacara eine echte Tierphysiologie besaßen. Wie seltsam auch immer diese Organismen aussahen, es scheint, als ob die Wurzeln des tierischen Stammbaums sogar noch weiter zurückliegen.
Originalstudie: Bobrovskiy, Ilya & Nagovitsyn, Aleksey & Hope, Janet & Luzhnaya, Ekaterina & Brocks, Jochen. (2022). Guts, gut contents, and feeding strategies of Ediacaran animals. Current biology: CB. 10.1016/j.cub.2022.10.051.
Hinweis: Der Hauptautor der Studie ist am GFZ tätig, führte diese Studie jedoch im Rahmen seiner Arbeit an der Australian National University durch.