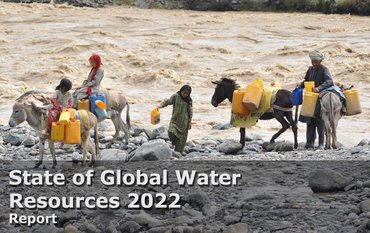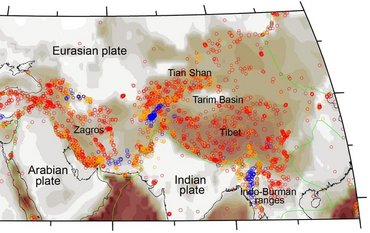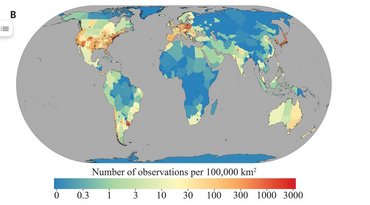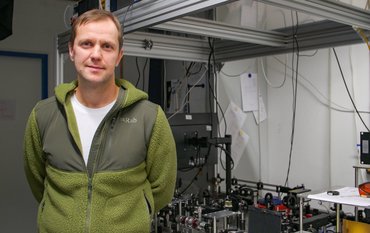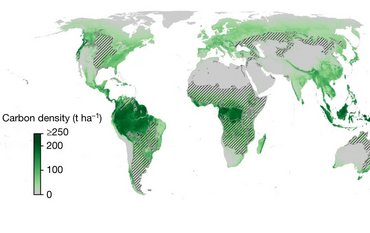Mit dem Humboldt-Forschungsstipendium fördert die Alexander von Humboldt-Stiftung überdurchschnittlich qualifizierte Postdoktoranden und erfahrene Wissenschaftler aus der ganzen Welt.
Dr. Anke Neumann ist seit kurzem als Senior-Humboldt-Forschungsstipendiatin in der Sektion 3.5 Grenzflächengeochemie tätig. Sie wird die nächsten 12 Monate am GFZ verbringen und mit Liane G. Benning und ihrem Team zusammenarbeiten, um Minerale in Nanogröße zu untersuchen, die durch die Wechselwirkung der gemeinsamen Boden- und Sedimentbestandteile Eisen und Tonminerale entstehen.
Anke Neumann erhielt sowohl ihren MSc als auch ihren PhD von der ETH Zürich, arbeitete als unabhängige Postdoktorandin in Bangladesch, dies in Kooperation mit der Eawag (Wasserforschungsinstitut des ETH-Bereichs)und der George Mason University und verbrachte ihre Postdoc-Stipendien an der University of Iowa. Danach wechselte sie als Dozentin an die Universität Newcastle, UK, wo sie bis heute als Senior Lecturer tätig ist.
Das Forschungsprojekt
Tonminerale sind in Sedimenten und Böden allgegenwärtig und galten lange Zeit als weitgehend reaktionslos, haben sich jedoch inzwischen herausgestellt als potenziell wichtige redoxaktive Minerale in der Natur. Interessanterweise führt ihre Wechselwirkung mit dem in der Natur reichlich vorhandenen Reduktionsmittel Eisen zur Bildung vorübergehender, aber hochreaktiver Mineralspezies, die in der Lage sind, schwer abbaubare Schadstoffe abzubauen. Wir vermuten, dass die Mineralidentität und Kristallinität dieser Mineralspezies der Schlüssel für die beobachtete Reaktivität und damit für das Verständnis ihrer Rolle in vielen wichtigen Elementkreisläufen der Erde sowie für die Nährstoffverfügbarkeit und den Schadstoffabbau ist.
Die Zielminerale sind wahrscheinlich amorph oder nanokristallin, kommen in geringer Menge vor und bestehen meist aus Partikeln von sehr geringer Größe (Nanometerbereich). Daher werden Analysewerkzeuge benötigt, die diese Nanophasen nicht nur identifizieren, sondern auch vollständig charakterisieren können. Am GFZ werden die hochauflösende Transmissionselektronenmikroskopie (HR-TEM) und die Methode der atomaren Paarverteilungsfunktion (PDF) eingesetzt und durch die Mössbauer-Spektroskopie an der Universität Newcastle ergänzt. Die Erkenntnisse aus diesem Projekt werden unser Verständnis darüber verbessern, wie Redoxreaktionen von Tonmineralen die Identität und Reaktivität reaktiver mineralischer Zwischenprodukte steuern und damit auch, wie Tonminerale Redoxreaktionen auf der Erde steuern.